| [Zurück zum Forschungsbericht] |
 |
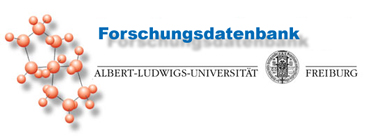
Pilotprojekt zur Integration von Fernerkundung und Betriebsinventur zum Zwecke der Anlagevermögensbewertung für den Staatswald des Forstamts MÜnster im Land Nordrhein-Westfalen
Projektbeschreibung:Bearbeitungshintergrund Folgende Entwicklungen erfordern eine Anpassung der Forsteinrichtung an veränderte Rahmenbedingungen und Zielsetzungen: Durch die geplante Einführung der Anlagevermögensbewertung für den Staatswald im Land Nordrhein-Westfalen kommt der Objektivität und Genauigkeit der Datenbasis aus der Forsteinrichtung besondere Bedeutung zu. Durch die Vergabe der Forsteinrichtung an Unternehmer ist die Überprüfbarkeit der erhobenen Informationen von hoher Bedeutung. Durch waldbauliche Konzeptionen, die zu strukturreicheren Beständen führen, kommt der Information über die variablen Verhältnisse innerhalb von Beständen höhere Bedeutung zu. Technische Entwicklungen der Erhebungsmethodik im Bereich Inventuren und Fernerkundung Neue Aufgaben der Informationsbereitstellung (Zertifizierung, ökologische Aspekte). Bearbeitungsziele Aufgabe des Vorhabens ist es, neue methodische Ansätze zur Erhebung von Zustandsdaten im Rahmen der Forsteinrichtung zu untersuchen. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen zwei Möglichkeiten zur Erneuerung und Verbesserung der Zustandserfassung im Rahmen der Forsteinrichtung: Nutzung einer Betriebsinventur zur Zustandserfassung und zur Erfassung von Veränderungen Nutzung von Fernerkundungsdaten zur Zustandserfassung und zur Erfassung von Veränderungen. Ergebnisse I) Darstellung der Möglichkeiten zur Bestandesausscheidung und Bestandesbeschreibung auf Basis von Fernerkundungsdaten Die Nutzung von CIR - Bildern einer aktuellen Befliegung im Rahmen der Forsteinrichtung bietet folgende Möglichkeiten: (i) Eine hohe Qualität der Bestandesbeschreibung durch den einfachen Überblick über den gesamten Bestand. (ii) Die Möglichkeit objektive und überprüfbare Daten bereitzustellen. (iii) Zusätzliche Informationen über Strukturen und Einzelerscheinungen innerhalb von Beständen können auf wirtschaftliche Weise kartiert werden. Die Erhebung von Strukturen innerhalb von Beständen ist von hoher Bedeutung. Durch die Nutzung des Luftbildes können Strukturen innerhalb der Bestände ohne hohen Zusatzaufwand erfaßt werden. Der bisherige Merkmalskatalog ist an die Restriktionen des bisherigen terrestrischen Verfahren gebunden und sieht solche Merkmale nur begrenzt vor. (iv) Die Möglichkeit eine Orthophotokarte zusätzlich zu oder an Stelle der kolorierten Betriebskarte bereitzustellen. Eine solche CIR-Orthophotokarte bietet für die Forstein-richtung und den laufenden Forstbetrieb wichtige und umfangreiche Informationen über Strukturen innerhalb von Beständen. Dies ist um so mehr von Bedeutung je strukturreicher die Bestände sind, denn es können nicht alle strukturellen Informationen in Form von Bestandesbeschreibungen und Kartierungen erfaßt werden. (v) Die Möglichkeit zeitaufwendige terrestrischen Bestandesbegänge in ihrem zeitlichen Umfang zu reduzieren. (VI) Die Möglichkeit auf zeitaufwendige terrestrische Bestandesbegänge in bis zu 90% der Bestände zu verzichten, falls die Forsteinrichtungsverfahren dem Informationspotential aus dem CIR Luftbild und aus der Betriebsinventur angepaßt werden. Diese Anpassung kann in Abwägung von Informationsbedarf und Informationskosten erfolgen. Eine solche Anpassung könnte z.B. durch eine Reduzierung des Merkmalsumfangs der Einzelbestände um die Merkmale erreicht werden, die mittels der Betriebsinventur für den Gesamtbetrieb und größere Aussageeinheiten mit großer Genauigkeit ermittelt werden. Für eine hohe Qualität der Interpretation ist eine stereoskopische Nutzung der Bilder unabdingbar und eine analoge Interpretation am Tischstereoskop ausreichend. Für die Erstellung und Aktualisierung der Bestandeskarten durch Erfassung der Bestandesgrenzen bietet die Digitalisierung auf dem Orthophotobild am Bildschirm optimale technische Voraussetzungen und Zeit- und Kosteneffektivität. Bei Verfahrensteilkosten von der Befliegung bis zur Bereitstellung als digitale Orthophotokarte von etwa 3,50 DM je ha Waldfläche, bei Kosten für die Interpretation von etwa 10 bis 11 DM je ha Waldfläche ist zu erwarten, daß die Gesamtkosten dieses Verfahrens mit Nutzung von CIR- Luftbildern günstiger sind, als die Kosten des bisherigen Verfahrens. Die Nutzung der CIR-Bilder ist auch gegenüber der Variante wirtschaftlicher, die Archivdaten des Landesvermessungsamtes nutzt. Diese weist zwar geringere Datenkosten auf, macht dafür aber bei mangelnder zeitlicher Aktualität der Bilder einen höheren terrestrischen Erhebungsaufwand erforderlich. Die Nutzung der Archivbilder des Landesvermessungsamtes stellt nur dann eine günstige Alternative dar, wenn der zeitliche Ablauf der Forsteinrichtung an die Zeiten der Befliegungen des Vermessungsamtes angepaßt wird. Dann liegen aktuelle Normalfarbbilder vor, die in vergleichbarer Weise wie die CIR-Bilder genutzt werden können, wenngleich sie nicht den vollen Informationsgehalt der CIR-Bilder aufweisen. Da diese Archivdaten nur Kosten von etwa 0,50 DM je ha Waldfläche aufweisen, könnte diese Alternative dann wirtschaftlicher sein. Die Nutzung der pan- und multispektralen Satellitendaten des Satelliten IRS-1C mit einer räumlichen Auflösung von 5 Metern im panchromatischen Kanal kann keinen effektiven wirtschaftlichen Beitrag zur Forsteinrichtung erbringen. II) Beschreibung der Methodik für eine stratifizierte Auswertung im Rahmen der Betriebsinventur Bei der Betriebsinventur sind Schätzer für Mittelwerte und Schätzer für Quotienten erforderlich. Die notwendigen statistischen Schätzer zur Nutzung der Stratifizierung unter systematischer Verteilung der Stichproben im Gelände wurden aus der Fachliteratur zusammengestellt und im Bereich der Schätzung von Quotienten durch eigene Herleitungen ergänzt. III) Darstellung des Genauigkeitsgewinns durch stratifizierte Auswertung im Rahmen der Betriebsinventur Die Nutzung der Stratifizierung bietet die Möglichkeit auf etwa 25 % der terrestrischen Stichprobenaufnahmen zu verzichten. Es handelt sich um eine relative Einsparmöglichkeit. Bei einer Netzdichte von 250 * 250 anstelle einer sonst notwendigen höheren Netzdichte, würde die Anwendung der stratifizierten Auswertung eine Kostenersparnis von 8 DM je ha Waldfläche ermöglichen. Die Stratifizierung in Verbindung mit einem systematischen Netz bietet ein Optimum an notwendiger Einfachheit und statistischer Effizienz. IV) Methodische Möglichkeiten, besonders im wertvollen Altholz höhere Genauigkeiten der Information über den Holzvorrat zu erhalten Für dieses Teilziel wurden zwei technische Wege untersucht: A) Die zielorientierte Realisierung unterschiedlicher Netzdichten in den Straten. B) Die forstamtsspezifische Bildung von Straten. Zu A) Es konnte gezeigt werden, daß durch die Realisierung von höheren Netzdichten in einzelnen Straten bei gleichzeitiger Reduzierung der Netzdichte in anderen Straten (z.B. in jüngeren Beständen) die Betriebsinventur zielorientiert wirtschaftlich hoch effizienter durchgeführt werden kann. Nachteile durch diese Lösung entstehen jedoch bei Folgeinventuren (durch Gewichtungsprobleme bei der Auswertung), bei einer Neuorganisation der Forstämter (durch Gewichtungsprobleme bei der Auswertung) und bei einer geänderten Zielsetzung in z.B. 20 oder 30 Jahren. Diese werden als schwerwiegender bewertet, als die erreichte Optimierung der Zustandserfassung einer Einzelinventur. Zu B) Generell gibt es zwei Möglichkeiten bei der operationellen Nutzung der Stratifizierung: Eine Stratifizierung nach einheitlichen Kriterien für alle Forstbetriebe. Eine Stratifizierung nach forstamtspezifischen Kriterien für alle Forstbetriebe, die die unterschiedliche naturale Struktur der Forstämter berücksichtigt. Die Zusammenfassung von Einzelbeständen zu Straten nach einem einheitlichen Schema führt bereits, verglichen mit der einfachen Hochrechnung (einfachen Zufallsauswahl), zu einer wesentlich höherer Genauigkeit der Schätzungen. Werden die Kriterien der Zuordnung von Beständen zu Straten für jedes Forstamt separat durchgeführt, kann damit die Effizienz der Stratifizierung weiter erhöht werden. Im Forstamt Münster konnten durch angepaßte Stratenbildung besonders bei der Baumart Eiche und bei der Auswertung nach Altersklassen in den älteren Altersklassen die Merkmale wesentlich genauer geschätzt werden. Der zusätzliche Aufwand für eine spezifische Stratenbildung innerhalb von Forstämtern wird als gering eingestuft und kann mit geringem Zusatzaufwand im Rahmen eines Auswertungsprogramms realisiert werden. Eine forstamtsübergreifende Auswertung wird dadurch nicht erschwert. V) Darstellung des Einflusses unterschiedlicher Netzdichten auf die Genauigkeit der Ergebnisse der Betriebsinventur Wegen unterschiedlicher Flächengröße der Forstämter ist folgende Betrachtung notwendig. Da die Varianz der Merkmale mit Zunahme der Fläche bei weitem nicht im selben Maße zunimmt wie der Stichprobenfehler der Merkmalsschätzungen bei flächenproportionalem Stichproben-umfang, können in einem groben Rahmen generelle Mindeststichprobenumfänge abgeleitet werden. Es sollten bei einer Stichprobeninventur, als grobe Faustzahl, nicht weniger als 500 Stichproben innerhalb eines Forstamts erfaßt werden. Die Mehrzahl der Forstämter bewirtschaftet relativ große Staatswaldflächen. Bereits mit einer Netzdichte von 250m mal 250m werden Stichprobenumfänge bei 13 Forstämtern von 595 bis 2088 je Forstamt erreicht. Lediglich in drei Forstämtern ist eine Dichte von 125m mal 250m erforderlich, um Stichprobenumfänge von 657 bis 962 zu erreichen. Mit diesen Vorgaben können unter Nutzung der Stratifizierung in der Mehrzahl der Forstämter Stichprobenfehler beim Gesamtvorrat von unter 1,5 % erreicht werden. Für keines der Forstämter liegt der Fehler über 2 %. Mit Einhaltung dieser Vorgabe für den Gesamtvorrat sind durch die gegebenen Varianzen der großen Zahl an Merkmalen, die bei einer Betriebsinventur erhoben werden, für die anderen Merkmale mehrheitlich größere Fehler verbunden. Die sich ergebenden Genauigkeitsverhältnisse wurden dargestellt. VI) Darstellung der Möglichkeiten zur Bestandesbeschreibung durch die kNN-Methode Die Nutzung der kNN- Methode kann auf Grund der geringen Schätzgenauigkeit zur Information über Bestände im Rahmen der Forsteinrichtung keinen substantiellen Beitrag erbringen. Sie ist jedoch geeignet um für Wälder Grundinformationen bereitzustellen. Dies kann etwa für den Kleinprivatwald von Bedeutung sein, der in NRW einen hohen Anteil der Waldfläche einnimmt. VII) Entwicklung von Verfahrensvorschlägen zur Integration von Fernerkundung in die Forsteinrichtung Die Einführung der Betriebsinventur führt zu einem deutlich höheren Standard an Informationen auf Betriebsebene und auf der Ebene großflächiger Aussageeinheiten innerhalb des Staatswaldes eines Forstbezirks. Mit der Einführung einer Betriebsinventur stehen objektive Zustandsdaten zur Verfügung, nach der ersten Wiederholungsinventur (oder bereits mit der Erstinventur auf Basis der wiedererfaßten Punkte der LWI bei ausreichendem Zeitabstand von 4-5 Jahren) sind ferner objektive Daten über Zuwachs- und Veränderung verfügbar. Damit wird für die Gesamtplanung und die Kontrolle auf Betriebsebene ein Niveau an verfügbarer Information erreicht, das wesentlich über dem bisherigen Verfahren liegt. Die Nutzung der Stratifizierung kann dabei die Genauigkeit ohne jeden zusätzlichen Erhebungsaufwand deutlich steigern. Erforderlich ist eine genaue Erfassung der Bestandesflächen, die durch die luftbildgestützte Kartierung erreicht werden kann. Mehrkosten gegenüber dem terrestrischen Kartierverfahren entstehen lediglich durch die Kosten für die Beschaffung der digitalen Orthobilder. Deren Beschaffung ist jedoch, wie oben dargestellt, bereits durch die Nutzung zur Bestandesbeschreibung betriebswirtschaftlich gerechtfertigt. Eine Steigerung der Genauigkeit der Erfassung des Zuwachses und von Veränderungen durch die Stratifizierung kann ebenfalls erwartet werden, konnte jedoch in der Testinventur nicht untersucht werden, da noch keine Wiederholungsaufnahme vorlag. Die zusätzlichen Kosten durch die Betriebsinventur gegenüber dem bisherigen Verfahren der Summierung bestandesweiser Information können durch effiziente, zielgerichtete Gestaltung des Designs und der Auswertung der Inventur begrenzt werden. Sie können ferner dadurch reduziert werden, daß die Aufnahmeparameter am Einzelbestand bei der Bestandesbeschreibung reduziert werden, und zwar um die Parameter, die ausschließlich der Gesamtplanung dienen. Die Nutzung aktueller CIR Bilder, ergänzt durch in reduziertem Umfang notwendige terrestrische Bestandesbegänge und durch eine Betriebsinventur, stellt sowohl durch die aus den Bildern ableitbaren Informationen für die Bestandesbeschreibung, als auch durch die Steigerung der Effizienz der Betriebsinventur eine wirtschaftliche Option für die Informationsbereitstellung im Rahmen der Forsteinrichtung dar. Die kalkulatorisch ermittelten Gesamtkosten der Einführung einer Betriebsinventur (24 DM/ha bei 250 m mal 250 m Netzdichte und Kosten von 150 DM je Stichprobenpunkt) und der Nutzung der CIR-Bilder (ca. 14 DM je ha) liegen mit 38 DM im Bereich der derzeitigen Marktpreise der Forsteinrichtung in NRW und machen etwa 50 % einer vergleichbaren kalkulatorischen Herleitung der Kosten des herkömmlichen Forsteinrichtungsverfahrens in NRW (ca. 80 DM je ha, mündliche Mitteilung der LÖBF/LAfAO) aus. Insgesamt stellt die Integration dieser Neuerungen objektivere, besser überprüfbare und umfangreichere Information zur Verfügung, die den geänderten Rahmenbedingungen Rechnung tragen.Projektlaufzeit:
Ansprechpartner: Dees M
Projektbeginn: 1999Projektleitung:
Projektende: 2000
DEES M, KOCH BFinanzierung:
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
- Nordrhein Westfalen, Land
Aktueller Forschungsbericht